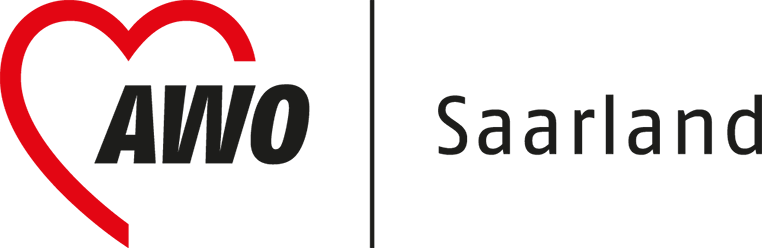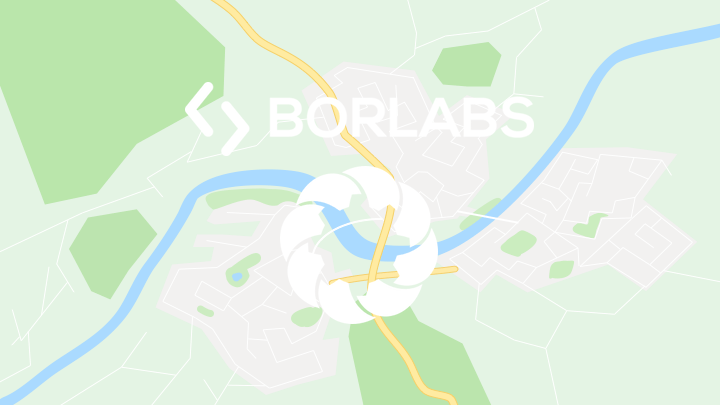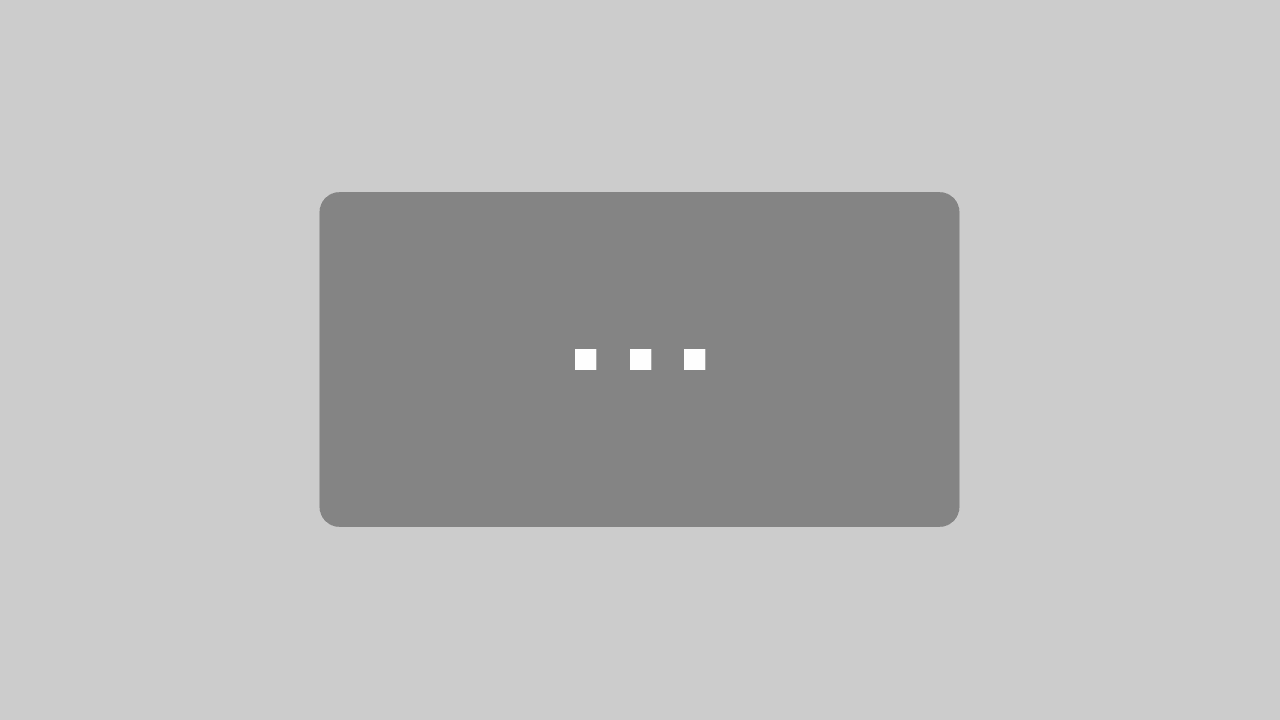Wer im häuslichen Umfeld eine Person pflegt, lernt seine Belastungsgrenzen kennen – seelisch oder körperlich. Wir bieten Ihnen kostenlose Beratung und passgenaue Angebote für die Verhinderungspflege. Jede(r) Pflegebedürftige(r) hat Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung, wenn die pflegenden Angehörigen oder Bekannten verhindert sind – stunden- oder tageweise.
Auch nahe Angehörige können eine Verhinderungspflege ausüben. So können Notfälle, Kurzurlaube oder terminliche Probleme von Pflegepersonen beispielsweise durch den Einsatz eines ambulanten Pflegedienstes abgesichert werden.
Pflegepersonen, die durch die Verhinderungspflege zeitweise ersetzt werden, müssen mindestens zehn Stunden je Woche häuslich pflegen und die Pflege einer pflegebedürftigen Person mit mindestens Pflegegrad 2 seit mindestens einem halben Jahr ausüben.
Wie viel Verhinderungspflege können Sie in Anspruch nehmen?
Die Verhinderungspflege kann für maximal 42 Tage und bis zu einer Höchstgrenze von 1.612 Euro pro Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Ab dem Pflegegrad 2 wird das Pflegegeld hälftig für bis zu sechs Wochen weitergezahlt.
Der Leistungsbetrag der Verhinderungspflege kann zusätzlich zu dem Ihnen für die Kurzzeitpflege zustehenden Leistungsbetrag um bis zu 806 Euro (50 Prozent der Kurzzeitpflege) auf insgesamt 2.418 Euro erhöht werden. Voraussetzung ist, dass für diesen Betrag noch keine Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wurde.
Die Verhinderungspflege wird von Ihnen selbst organisiert und kann in verschiedenen Varianten genutzt werden:
1. Häusliche Verhinderungspflege: Das vornehmliche Ziel der Verhinderungspflege ist die Sicherstellung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen im eigenen Zuhause. Für die Ersatzpflege durch Pflegekräfte eines ambulanten Pflegedienstes stehen 1.612 Euro pro Kalenderjahr zur Verfügung
2. Stundenweise Verhinderungspflege: Die Verhinderungspflege kann auch in mehreren Teilzeiträumen und stundenweise in Anspruch genommen werden. Für Tage, an denen die Ersatzpflege nicht mindestens acht Stunden erbracht wird, erfolgt keine Anrechnung auf die Höchstdauer von 28 Tagen im Kalenderjahr. Auch das Pflegegeld wird in diesem Fall nicht gekürzt.
3. Verhinderungspflege kann auch in einer unserer Tagespflegeeinrichtungen erfolgen.
4. Verhinderungspflege in einer stationären Pflegeeinrichtung.
5. Verhinderungspflege am Urlaubsort: Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe sogenannter Pflegehotels an Urlaubsorten. Die Pflege wird hier entweder von geschultem Personal des Hotels oder von einem vor Ort ansässigen Pflegedienst übernommen und kann über die Verhinderungspflege abgerechnet werden.
Verhinderungspflege kann stunden- oder tageweise in Anspruch genommen werden – je nachdem, wie lange die Pflegeperson verhindert ist. Eine Beratung zur Verhinderungspflege ist unbedingt notwendig, um den Umfang und die Dauer der Ersatzpflege zu vereinbaren.
Was muss ich tun?
Die Verhinderungspflege erfordert eine Antragstellung bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person. Im Notfall ist es auch möglich, nachträglich Belege zur Erstattung einzureichen. Die Kosten der Verhinderungspflege werden (nach Erfüllung der Voraussetzungen) durch die Pflegekasse bis zum Höchstsatz erstattet. Der Anspruch verfällt zum Ende eines Kalenderjahres.